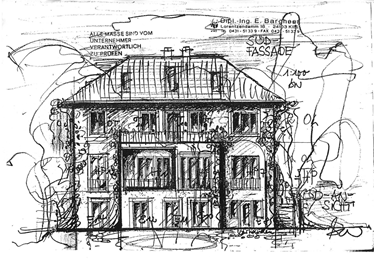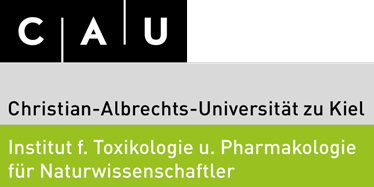Unsere Seminare beim

01.10.26 Pestizide
23.06.25 Herkulesstaude
12.03.25 Arzneimittel
24.06.24 Herkulesstaude
30.05.24 Flächenverbrauch
22.06.23 Herkulesstaude
23.06.22 Herkulesstaude
18.11.19 Wasserschutz
31.01.19 Umweltbildung
13.09.18 Urban Gardening
11.06.18 Ernährungsräte
01.09.17 Pestizide
Der Landesverband hat Stellung bezogen ...
ELER-Fördergesetz Schleswig-Holstein
Kiel, 30. November 2024 - mit Blick auf die Anzuhörendenliste fällt auf, dass diese sehr überschaubar ist, handelt es sich doch immerhin um einen Gesetzesentwurf geplant für eine Fördermittelvergabe in Millionenhöhe. Entscheidend werden die Verordnungs-Ermächtigungen sein. Der vorgelegte Gesetzesentwurf bildet vielmehr nur die Grundlage für die dann weiter gehenden Regelungen für die Praxis. Nichtsdestotrotz erlauben wir uns einige Anmerkungen.
Mehr… Weniger…Solar-Erlass - Chancen zur Doppelnutzung landwirtschaftlicher Flächen nicht ausgeschöpft
Download Stellungnahme
Solarerlass
Kiel, 5. April 2024 - der Entwurf eines Beratungserlasses vom März 2024 fasst im Wesentlichen geltende Rechtsvorschriften zur Freiflächenphotovoltaik (FF-PV) in einem Schriftstück zusammen. Dies gewährt an entsprechenden Vorhaben Beteiligten einen erleichternden Gesamtüberblick, der infolge des neuen „Solarpakets“ der Bundesregierung hilfreich sein kann.
Mehr… Weniger…Das Vorkaufsrecht des Landes für Naturschutzflächen hat sich bewährt
Download Stellungnahme
Vorkaufsrecht des Landes
Kiel, 26. Januar 2024 - die NaturFreunde S-H lehnen den Antrag der FDP-Landtagsfraktion - die ersatzlose Streichung des § 50 Landesnaturschutzgesetz, also die Abschaffung des Vorkaufsrechtes des Landes für Flächen, die zur Umsetzung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege gemäß § 1 Bundesnaturschutzgesetz von besonderer Bedeutung sind - ab.
Mehr… Weniger…Eine Weidetierprämie für alle Tierhalter - die Kuh gehört aufs Grünland!
Download Stellungnahme
Weidetierprämie
Kiel, 30. Januar 2023 - die NaturFreunde S-H unterstützen den Antrag „Weidetierprämie stärken“. In Schleswig-Holstein wie bundesweit gibt es bereits diverse Prämien zur Weidetierhaltung, sei es für definierte Gebietskulissen oder bestimmte Haltungsformen. Diese gilt es nun auszuweiten, nutzbar für alle Tierhalter.
Mehr… Weniger…Neue Landesdüngeverordnung - Trippelschritte bei der Umsetzung von seit 22 Jahren überfälligen EU-Vorschriften
Download Stellungnahme
Landesdüngeverordnung
Kiel, 30. September 2022 - die nun erweiterten Vorgaben der Düngeverordnung des Bundes (DüV) und der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten und eutrophierten Gebiete (AVV GeA) werden von den NaturFreunden SH begrüßt. Zu befürchten ist allerdings, dass auch dieser Entwurf einer Landesverordnung bis zur endgültigen Abwehr eines Vertragsverletzungsverfahrens möglicherweise nicht der letzte Schritt auf dem Weg zu einem effektiven Ordnungsrecht sein dürfte.
Mehr… Weniger…Für mehr Abstand zu Gewässern bei der Pestizidausbringung!

Download Stellungnahme
NaturFreunde S-H zur
Pflanzenschutzanwen-
dungsverordnung S-H
Kiel, 25. März 2022 - Bundesweit gelten seit dem letzten Jahr neue Regelungen für Abstände bei der Pestizidausbringung an Gewässern, da die bisherige Regelung ohne Abstand bzw. von nur einem Meter in Schleswig-Holstein einen Eintrag von Pestiziden in die Wasserläufe ermöglichte. Die jetzt von Land Schleswig-Holstein anvisierten pauschalen Ausnahmen für nahezu ein Drittel der Landesfläche von Schleswig-Holstein steht im krassen Widerspruch zur eigentlichen Intention des Gesetzgebers.
Mehr… Weniger…Schlechtes Zeugnis für den ökologischen Zustand der Flensburger Förde
Kiel, 28. Februar 2022 - Der Bericht der Landesregierung zum "schlechten ökologischen Zustand" der Flensburger Förde geht jetzt in die Anhörung des Landtags. Als Hauptursache benennt er die viel zu hohen Nährstoffeintrage aus der Landwirtschaft. Das überrascht uns nicht. Die seit mehr als zwanzig Jahren von Umweltverbänden, Wissenschaft und Wasserversorgern angemahnte erforderliche Anpassung des landwirtschaftlichen Ordnungsrechtes und der Agrarförderung wurden nicht in ausreichendem Maße angegangen. Die Landesregierung setzt auf die Wirksamkeit der geltenden Düngeverordnung, um die erforderliche Trendwende hin zum „guten ökologischen Zustand“ der Förde zu erreichen. Nach Ansicht der NaturFreunde S-H reicht dies keineswegs.
Energiewende- und Klimaschutzgesetz
Kiel, 27. September 2021 - Um globale Klimaschutzziele zu erreichen, muss das Land alle Möglichkeiten ausschöpfen. Die NaturFreunde begrüßen eigene Regelungen für Schleswig-Holstein. Für weitergehende Ziele fehlen dem Gesetzgeber offensichtlich die Rechtsgrundlagen. Nichtsdestotrotz wurden Spielräume nicht ausgeschöpft.
Mehr… Weniger…Photovoltaikanlagen auf Freiflächen
Kiel, 19. März 2020 - Ohne einen erheblichen Ausbau der Solarenergie werden die Klimaschutzziele für Schleswig-Holstein nicht zu erreichen sein. Zugleich steht aber die flächenmäßige Inanspruchnahme in Konkurrenz zu anderen Zielen und Ansprüchen, wozu es eindeutiger Regelungen bedarf.
Mehr… Weniger…Neue DüngeVO setzt Nährstoffüberfrachtung der Ökosysteme fort
Kiel, 6. November 2020 - Bedauerlicherweise verbleiben bis zur Abgabe nur wenige Tage - dies bei einem in hohem Maße komplexen Thema mit umfassenden Detailregelungen und komplizierten methodischen Vorgaben. Insofern begrenzen wir uns auf wesentliche Punkte. Die Düngeverordnung des Bundes erteilt den Ländern lediglich marginale Kompetenzen für weitergehende wasser-wirtschaftlich wirksame Verschärfungen.
Mehr… Weniger…Clearingstelle Windenergie kommt zu spät
Fassadenbegrünung ist zugleich Gesundheitsprävention
Kiel, 4. August 2020 - der Landesverband NaturFreunde begrüßt ausdrücklich die Initiative der SPD-Fraktion die Wohnraumförderung des Landes sowie die städtebauliche Gestaltung unserer Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein stärker nach sozialen und nachhaltigen Kriterien auszurichten. Bedauerlicherweise scheint in diesem Kontext die Bedeutung von Fassaden- und Dachbegrünungsmaßnahmen für die Gesundheitsprävention der Bevölkerung in den Städten und Gemeinden nur am Rande im Fokus des Antrages gestanden zu haben.
Mehr… Weniger…Landesplanung: Keine Experimente zu Lasten des Naturschutzes
Die Toxikologie muss als eigenständiges Institut erhalten bleiben
Kiel, 14. März 2020 – Eines der letzten fünf unabhängigen Institute für Toxikologie steht auf der Kippe. Zwar soll der Name Umweltmedizin mit weitergeführt werden, inhaltlich ist jedoch eine Neuausrichtung der Forschung auf Digitale Medizin, Onkologie und Neurologie geplant. Die Umwelttoxikologie würde dadurch aber unter den Tisch fallen.
Mehr… Weniger…Wie kommt mehr Wald nach Schleswig-Holstein?
Kiel, 3. Februar 2020 - Die NaturFreunde Schleswig-Holstein begrüßen, dass die CDU-Landtagsfraktion den Wald als wichtiges Handlungsfeld gegen den Klimawandel in unserem Bundesland aufgegriffen hat. Das 12-Prozent-Ziel erscheint auf den ersten Blick im Hinblick auf den Bundesdurchschnitt bescheiden.
Mehr… Weniger…Wir brauchen eine Regulierung von Plastikmüll-Exporten
Klimaschutz gehört in die Landesverfassung
Kiel, 6. Mai 2019 - Eine explizite Erwähnung des Klimaschutzes in der Landesverfassung, hier in Artikel 11, wird von den NaturFreunden S-H ausdrücklich begrüßt. Das Verfehlen der Klimaschutzziele für 2020 durch die Bundesregierung zeigt, welche Folgen das Nichthandeln, verspätetes, inkonsequentes oder falsches Handeln im Klimaschutz haben kann.
Mehr… Weniger…Der Wolf - für Schafe nicht unbedingt gefährlicher als der Hund
Kiel, 12. Mai 2018 - Als meiner Generation noch Gute-Nacht-Geschichten vorgelesen wurden, erschien „Wickie und die starken Männer“. Darin finden wir den Satz „Der Umkreis von Flake wurde als der erste wolfsfreie bekannt, 60 Jahre später sind wir erwachsen, abgeklärt und wissen: Es gibt keine wolfsfreien Gebiete.
Mehr… Weniger…Neue Landesdüngeverordnung löst das Nitratproblem nicht
Kiel, 29 März 2018 - Das Land muss aus 14 in der DüngeVO vom 2. Juni 2017 genannten Maßnahmen mindestens drei für eine LandesdüngeVO auswählen. So sollen die Nitratgehalte im Grundwasser und die Phosphatgehalte in Oberflächengewässern in den sogenannten belasteten Gebieten reduziert werden.
Mehr… Weniger…Wo bleibt der Ausstiegsplan für Glyphosat?
Ökokonto-Verordnung gut - Flächenverbrauch geht weiter